 Amsterdamer
AmsterdamerVertrag
 Beitrags-
Beitrags-konferenz
 Vertrag
Vertragvon Nizza
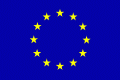 § "Titel V" §
§ "Titel V" §Die EU- Rechtsvorschriften
 Das Bundes-
Das Bundes-Verfassungsgesetz
 Links
Links
 Amsterdamer
AmsterdamerVertrag |
|||||
 Beitrags-
Beitrags-konferenz |
 Vertrag
Vertragvon Nizza |
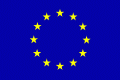 § "Titel V" §
§ "Titel V" §Die EU- Rechtsvorschriften |
 Das Bundes-
Das Bundes-Verfassungsgesetz |
 Links
Links |

Der Vertrag von Amsterdam sollte die Widersprüche beseitigen, die zwischen den besonders ehrgeizigen gemeinsamen Zielen der GASP und den der Union zur Verfügung stehenden Mitteln zu ihrer Verwirklichung bestehen, die offenbar den Erwartungen und den gegenwärtigen Herausforderungen nicht gerecht werden.
Im Vertrag von Amsterdam wurde der operative Charakter der GASP durch kohärentere Instrumente und ein effizienteres Beschlussfassungsverfahren verstärkt.
Gleichzeitig wurde der als "Petersberg-Missionen" bekannte Aufgabenkatalog im Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union festgeschrieben und ist für alle EU-Mitgliedstaaten gültig geworden.
Artikel 17 eröffnet ebenfalls zwei neue, vor allem langfristig zu sehende, Perspektiven - nämlich die einer gemeinsamen Verteidigung und die mögliche Integration der Westeuropäischen Union (WEU) in die Europäische Union.
Weiters sieht der neue Artikel 26 des Vertrags über die Europäische Union die Schaffung einer neuen Funktion vor, die zu einer größeren Sichtbarkeit und einer stärkeren Kohärenz der GASP beitragen wird - den Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.
Er unterstützt den Rat in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, indem er insbesondere zur Formulierung, Vorbereitung und Durchführung politischer Entscheidungen beiträgt. Auf Ersuchen des Vorsitzes führt er im Namen des Rates den politischen Dialog mit Dritten.
Das bisherige Verfahren, wonach Beschlüsse im Bereich der GASP immer einstimmig gefasst werden, wurde mit Amsterdam beibehalten. Die Mitgliedstaaten haben allerdings die Möglichkeit der konstruktiven Stimmenthaltung, was bedeutet, dass die Stimmenthaltung eines Mitgliedstaats einem Beschluss nicht entgegensteht. Ferner kann der betreffende Mitgliedstaat zu seiner Stimmenthaltung eine förmliche Erklärung abgeben und ist in diesem Fall nicht verpflichtet, den Beschluss durchzuführen, akzeptiert jedoch im Geiste gegenseitiger Solidarität, dass der Beschluss für die Union bindend ist. Er unterlässt daher alles, was dem Vorgehen der Union zuwiderlaufen könnte. Dieser Mechanismus - Stimmenthaltung mit einer förmlichen Erklärung - findet jedoch keine Anwendung, wenn die Mitgliedstaaten, die sich auf diese Weise der Stimme enthalten, über mehr als ein Drittel der gewogenen Stimmen im Rat verfügen.
Nicht erreicht, obwohl zumindest in Diskussion, wurde eine Beistandspflicht wie sie die NATO kennt. Hier war der Widerstand der "Neutralen" zu groß um zu einer Einigung zu kommen.
Der Vertrag von Amsterdam ist von allen Mitgliedsstaaten ratifiziert worden und am 1. Mai 1999 in Kraft getreten.